2002
• Große
Kunst der kleinen Form / Peter Schreier und der Liedgesang
•
"In
Bachs Musik ist kein Platz für Starallüren"
•
Kirkkomusiikin
ja liedin eminenssi
•
Der
Frauenkirche entgegenfiebern
•
Die
Bereitschaft zum Mitdenken und zum Mitfühlen
| 2017-2020 | 2013-2016 | 2010-2012 | 2007 - 2009 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | < 2002 |
Musikfreunde, Zeitschrift
der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien
Sept/Okt 2002
Große
Kunst der kleinen Form
Peter
Schreier und der Liedgesang
Ein Schubertiade-Konzert in Schwarzenberg, Juni 2002: Peter Schreier
dankt für den frenetischen Schlußapplaus und kündigt die Zugabe
an: "Ungeduld". Darauf ein Zuhörer, ihm fast ins Wort fallend
und vom Auditorium heftig akklamiert: "Jaaa!!!"
Die Ungeduld, mit der auf die "Ungeduld" gewartet wird - sie
ist eines der schönsten Komplimente, das man dem Sänger Peter Schreier
machen kann. Bestätigung einer Begeisterung, die über Generationengrenzen
hinwegreicht. Noch in den fünfziger Jahren sang Schreier als Student
"Die schöne Müllerin" bei einer Rundfunkproduktion. Seit
den späten sechziger Jahren gilt er als der führende Vertreter des
deutschen Liedgesangs im Tenorfach. Und nun, gut 37 Jahre nach seinem Debüt
im Musikverein, gastiert er wieder mit zwei Liederabenden bei der Gesellschaft
der Musikfreunde. Auf dem Programm: Beethoven-Lieder und Schuberts "Schwanengesang".
"Anspruchsvoll für den Sänger, aber auch für den Hörer",
sagt Schreier selbst, "also genau das richtige Programm für Wien!"
Und um gleich mit dem ersten Teil dieses Programms zu beginnen: Bedeutet Anspruch
bei Beethoven nicht auch eine unangemessene Beanspruchung der Stimme? "Sicher
gibt es einige Anhaltspunkte für die Behauptung, daß Beethoven
in seinen Liedern mehr instrumental als sängerisch gedacht hat - dynamische
Bezeichnungen wie ,rinforzato' etwa, die klar vom Instrumentalen her kommen.
Aber", meint Schreier, "es gibt Mittel und Wege, diese extremen
Bezeichnungen - ich will nicht sagen - zu nivellieren, aber doch ,mit Anstand
zu umschiffen', sodaß eine kantable Interpretation möglich ist."
Schreier spricht auch hier aus der jahrzehntelangen Erfahrung einer intensiven
Beschäftigung. 1970, im Beethoven-Jahr, hat er sich erstmals gründlich
auf dessen Lieder eingelassen. Die Faszination ist geblieben. Schreier war
einer der ersten, die sich mit reinen Beethoven-Lied-Programmen vors Publikum
wagten, und noch heute bricht er gern eine Lanze für Beethoven. Programme,
bei denen er Beethoven-Lieder mit Werken von Schubert oder Schumann konfrontiert,
fordern ihn, wie er selbst sagt, "besonders heraus, Beethoven in seiner
Eigenart, aus seiner Zeit und Kompositionsweise, zu verstehen und zu interpretieren".
Dramen in nuce
Der Blick auf Beethovens Gesamtschaffen ist dabei wesentlich. Denn die Lieder
stehen in einem größeren, auch Gattungsgrenzen überschreitenden
Entwicklungsgang. "Nehmen Sie das Lied ,Andenken'!", sagt Peter
Schreier. "Dessen Hauptthema wird dann später in der viel größer
angelegten ,Chorphantasie' ausgebreitet, und die ist dann wieder eine Vorstufe
zur Neunten Symphonie. Lieder, könnte man sagen, sehen Beethoven darum
ringen, auch in einem intimen Rahmen etwas auszusagen, was dann in den größeren
Werken ausgesprochen wird. Sie sind der Versuch - der sehr gelungene Versuch!
- die Beethovensche Dramatik auch in der kleinen Form aufzubauen. Und tatsächlich
sind ja einige Lieder so unglaublich in ihren Tempo- und Taktwechseln, daß
wirklich kleine Dramen daraus werden."
Letzte Lieder
Von Beethoven zu Schubert, vom Beethoven-Zyklus "An die ferne Geliebte"
zur "entfernten Geliebten", an die sich die Rellstab-Lieder des
"Schwanengesangs" wenden. Tatsächlich gibt es glaubhafte Hinweise
darauf, daß Schubert die Rellstab-Texte direkt aus Beethovens Nachlaß
übernommen hat - eine frappante Verbindung, und doch, welch ein Unterschied,
was für ein Aufbruch in neue Dimensionen ... Schreier sieht in den Heine-Liedern
"noch eine gewaltige Steigerung" gegenüber dem ersten Teil
des "Schwanengesangs": "mit weniger Mitteln eine größere
Aussage, einmalig und genial, unglaublich in die Tiefe gehende Lebensbilder".
Lebensbilder - oder doch eher Todesbilder? Sind diese Lieder, Schuberts letzte
vor seinem frühen Ende, Ausdruck einer Nähe zum Tod? Peter Schreier
ist da vorsichtig. "Der Österreicher, das weiß ich, neigt
ja sehr zu dieser Sicht und liebt es, diese dunkle Seite Schuberts auszukosten
und zu genießen. Da bin ich vielleicht weniger vorbelastet von meinem
Gemüt ..." Er jedenfalls sieht Schubert in seinen letzten Lebensmonaten
nicht als einen depressiven, dem Tod zuneigenden Menschen. "Die Wahrscheinlichkeit
seines Ablebens, seines Nicht-mehr-lange-Lebens, die glaubt ja keiner von
sich selbst!" Und so erscheinen ihm die ergreifenden Lieder des "Schwanengesangs"
auch eher als Ausdruck eines "Lebenskampfes" denn als Zeichen einer
"Todessehnsucht". "Ich kann mir nicht so recht vorstellen,
daß die Todessehnsucht solche Genieblitze hervorbringt", meint
er. "Und ich denke, daß Schubert, hätte er weitergelebt, in
diesen Dimensionen weitergearbeitet hätte."
Botschaft der Taubenpost
Freilich: die Frage bleibt letztlich müßig. "Es ist schwer",
sagt Schreier, "in die Psyche eines so genialen Komponisten so einzudringen,
daß man wirklich sagen könnte, das hat er aus Todesangst oder Todessehnsucht
geschrieben ..." Schubert, wie Peter Schreier ihn sieht, zeigt sich noch
einmal ganz deutlich in seinem allerletzten Lied, der "Taubenpost".
Sicherlich geht es da um ein Zentralthema Schuberts, die "Sehnsucht".
"Aber der Schluß, wie Schubert ihn schreibt, ist doch keine Resignation,
keine Todesahnung ... Das ist doch eher Hoffnung! Schubert läßt
es offen in Dur ... Und eben darin", sagt Peter Schreier, "sehe
ich die ganz typische Persönlichkeit Schuberts. Die wird mir zu sehr
in dieses Weltschmerz-Fach gelegt!"
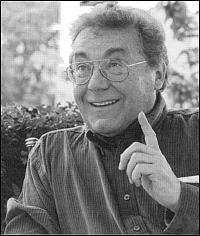
Der Weg zur "Winterreise"
Peter Schreier und Schubert: das ist auch die Geschichte einer jahrzehntelangen
Entwicklung. Mit dreißig hatte er schon ein beträchtliches Repertoire
an Schubert-Liedern, und die "Schöne Müllerin" war das
Herzstück darin. Doch erst mit fünfzig wagte er sich an die "Winterreise".
"Mein Verhältnis zur ,Winterreise' war geprägt durch Furcht
vor dem Zyklus", sagt Peter Schreier heute. "Ich stand vor der Frage,
ob ich ihn geistig und seelisch richtig erfassen kann: Habe ich genug durchgemacht,
daß ich die Situation der ,Winterreise' auch richtig verstehen kann?
Erlaubt mir mein Charakter, meine Veranlagung, die ,Winterreise' überzeugend
singen zu können?"
Svajatoslav Richter war es dann, der Schreier aus diesen Zweifeln holte. Er
wollte den Zyklus mit ihm aufführen, und die Wiedereröffnung der
renovierten Semper-Oper 1985 bot dazu den richtigen Anlaß. Dem Konzert
in Dresden gingen 14 Tage Proben in Berlin voraus - 14 Tage! Allein daraus
kann man ermessen, wie intensiv die Arbeit gewesen sein muß. "Mir
hat natürlich ungeheuer geholfen, daß Richter durch seine Persönlichkeit,
ein bißchen auch durch seine Wesensverwandtschaft mit Schubert, einen
ganz intensiven Zugang zu diesem Zyklus hatte", sagt Schreier. Was damals
entstand, ist bis heute prägend für Schreiers Verständnis der
,Winterreise' geblieben
- mit ganz wenigen Ausnahmen. "Daß wir den ,Lindenbaum' so wahnsinnig
langsam gemacht haben, war aus Richters Sicht begründet: Er sah in der
zweiten Strophe - ,Komm her zu mir Geselle, hier findst du deine Ruh' - schon
einen klaren Hinweis auf Tod und Selbstmord. Aber die Musik wendet sich hier
aus dem Moll-Bereich wieder nach Dur ... Und deswegen glaubte ich nicht so
recht daran und bin auch heute davon abgekommen."
Selbstverständliche Natürlichkeit
Es ist das Changieren zwischen den Farben, die Schubert ewig faszinierend
macht. Hinzu kommt jener Faktor, den Schreier mit dem Wort "volkstümlich"
nur unzureichend beschrieben findet. Worum es geht, ist die "Einfachheit",
die Fähigkeit, den Zuhörer ganz unmittelbar anzusprechen. In der
"Winterreise" sieht Schreier auch diese Schubertsche Qualität
vollendet ausgeprägt - genauso übrigens wie in den großen
Messen, jener in As-Dur und der in "Es", die er im November als
Dirigent der Hofmusikkapelle im Musikverein zur Aufführung bringen wird.
"Daß Schubert die höchste Kunst so mit Einfachheit verbinden
kann, daß er Töne findet, die das Verständnis und den Geist
des Menschen unmittelbar erreichen und ihn doch - unmerklich - in eine andere
Welt entführen": das macht für Peter Schreier das ganz Besondere
an Schuberts Musik aus.
Dieser Qualität sucht er auch als Interpret gerecht zu werden - und hier
treffen sich die Einsicht in Schuberts Welt mit Schreiers eigener Veranlagung.
"Ich bin immer mit einer gewissen Natürlichkeit herangegangen",
sagt er selbst über seinen Zugang zum Lied. "Etwas hineinzuinterpretieren,
das finde ich dem Werk nicht unbedingt zuträglich. Ich meine, es steht
genügend in den Noten. Und es gibt viele Möglichkeiten, mit Natürlichkeit,
einer selbstverständliche Natürlichkeit zu singen und damit den
Zuhörer viel mehr anzusprechen, als wenn ich etwas will. Diese Auffassung
stand für mich immer felsenfest: Dort gehörst du hin!"
Fragwürdiger Trend
Wie sieht Peter Schreier ganz generell die Situation im Liedgesang heute?
"Es geht leider wieder ein bißchen in Richtung ,Stimme zeigen!'",
findet Schreier und führt (diskret ohne Namensnennung) das Beispiel eines
erfolgreichen jungen Baritons an, den er kürzlich mit Brahms-Volksliedern
im Radio gehört hat - "mit Liedern also, die geradezu herausfordern
zu einer unterschiedlichen Gestaltung! Und doch singt das dieser junge Sänger,
als sei jede Strophe derselbe Inhalt! Und da dachte ich so bei mir: Was will
er? Will er bloß Stimme zeigen? Dann braucht er keine Brahms-Volkslieder
zu singen, gerade diese Lieder, in denen soviel Raffinesse steckt, in denen
die Begleitung schon soviel vorbereitet ... Nun gut", sagt Schreier attacca
fort. "Sie werden jetzt vielleicht sagen: Der hat gut reden, der hat
nicht so 'ne üppige Stimme, um unbedingt nur Stimme zu zeigen - und das
gilt ja für Fischer-Dieskau in gewissem Maße genauso. Ich meine,
da gab es Stimmen, die waren halt üppiger, größer, volumenreicher
und so weiter ... Aber das ist ja nicht das Prinzip, das ist ja nicht das
Lied! Stimme zeigen kann ich in der Oper! Aber das Lied ist eine Kunstgattung,
die diffizilste Gestaltung abverlangt!"
Positive Zeichen
Trotzdem: Peter Schreier registriert mit Freude, "daß die Ära
Fischer-Dieskau sicher viele junge Sänger angeregt hat, sich intensiv
dem Liedgesang zu widmen. Allein das ist schon mal ein positives Zeichen."
Und auch beim Publikum sieht er ein starkes Interesse an der Kunstform Lied:
"Die Menschen suchen wieder die intime Beschäftigung mit Kunst und
mit Musik, nicht nur das Laute und Spektakuläre, die großen Open-airs,
die zig drei Tenöre und was es da alles gibt ... Zu uns kommt ein anderes
Publikum. Und hier kann ich den Begriff ,elitär' auch einmal positiv
sehen. Wenn wir Liedsänger und das Liedpublikum ,elitär' sind, dann
bin ich dafür!"
Postskriptum zum Pensionsalter
Daß er selbst auch einen bedeutenden Anteil an dieser positiven Entwicklung
für sich in Anspruch nehmen könnte, sagt er nicht. Große Worte
sind nicht sein Fall. Statt dessen spricht er leise vom behutsam erwogenen
Abschied. "So langsam denke ich daran, mich als Sänger etwas mehr
zurückzunehmen. Ich möchte nämlich nicht, daß man sagt:
,Na ja, früher hat er alles viel schöner gemacht, da klang die Stimme
noch ...!' Und diesen Moment sollte man doch gut abpassen ..."
Ist das in Wien nicht ein bißchen anders, in dieser Stadt, die den großen,
über Jahrzehnte geliebten Sängern gerne einen besonderen Bonus gewährt?
Und diesen Bonus hat Peter Schreier, Ehrenmitglied des Musikvereins, doch
allemal ... Schreier bleibt Realist und reagiert pfiffig: "Auch dieser
Bonus kann mildernde Strafe sein! Nein, nein, die Leute sollen mich in guter
Erinnerung behalten. Und das war's dann auch ..." J.R.
Leipziger
Volkszeitung &
Dresdner Neueste Nachrichten 24./25.06.2002
"In
Bachs Musik ist kein Platz für Starallüren"
Erstmals
seit Bestehen des Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerbs, der
ab heute zum 13. Mal in Leipzig stattfindet, ist der Tenor Peter Schreier
Mitglied der Jury im Fach Gesang. Wir sprachen mit dem weltweit gefeierten
Sänger über sein Verhältnis zum großen Thomaskantor
und die Bedeutung internationaler Musik-Wettbewerbe in der heutigen Zeit.
Frage: Was war Ihr Schlüsselerlebnis in Sachen Bach?
Peter Schreier: Ich habe als Knabenalt im Kreuzchor viel Bach gesungen. Überhaupt
bin ich durch Bachs Großwerke wie Weihnachtsoratorium, h-moll-Messe
und die Passionen erst darauf gekommen, Sänger von Beruf zu werden.
Mein Verhältnis zu Bach ist von der Rolle des Evangelisten geprägt.
Bach hat in diesen hochdramatischen Part vielleicht am meisten Herzblut
hineingelegt.
Sie sind zum ersten Mal Juror beim Bach-Wettbewerb. Was hat Sie dazu
bewogen?
Ich habe mich bislang sehr auf das eigene Konzertieren konzentriert.
Ich war nie in größerem Umfang pädagogisch tätig
und saß auch erst zwei oder drei mal in einer Jury. Als Lehrer bin
ich wohl zu ungeduldig, jedenfalls beschränke ich mich auf gelegentliche
Meisterkurse, bei denen man mit fertig ausgebildeten Stimmen arbeitet.
Die Tätigkeit als Wettbewerbs-Juror hat mich eigentlich immer ein
wenig abgeschreckt, denn viele Wettbewerbe gleichen einem stilistischen
Tohuwabohu. Das ist beim Bach-Wettbewerb aber anders.
Inwiefern?
Es ist ein sehr spezieller Wettbewerb, der nicht nur Virtuosität
verlangt, sondern vor allem künstlerische Reife. Niemand kann Bach
wirklich gut singen, ohne diese Reife zu besitzen. In Bachs Musik ist
kein Platz für Starallüren. Das hat dieser Wettbewerb anderen
Konkurrenzen voraus.
Was meinen Sie sind Wettbewerbe die Sprungbretter zur ganz großen
Karriere?
Sie können es sein, aber sie sind es nicht zwangsläufig. Ich
habe bei keinem berühmten Lehrer studiert und habe auch keinen renommierten
Preis gewonnen und trotzdem meinen Weg gefunden. Wer wirklich etwas kann,
setzt sich früher oder später auch ohne Medaille durch. Andererseits
wird es für junge Menschen immer schwieriger, ihre Leistungen einer
breiten Öffentlichkeit vorzustellen. So gesehen ist ein großer
internationaler Wettbewerb wie der Bach-Wettbewerb eine wichtige Hilfe
beim Start ins Berufsleben.
Was wünschen Sie den rund einhundert Sängern, die aus aller
Welt nach Leipzig kommen?
Ich wünsche den Sängern und uns allen hochwertige künstlerische
Erlebnisse und Erfahrungen, die das rein Rechnerische einer Rangfolge
vergessen lassen. Letztlich hat es immer hervorragende, bessere und weniger
gute Musiker gegeben. Die Jury wird zwischen ihnen unterscheiden und die
besten zum Preisträger küren.
Interview:
Jörg Clemen
Turun
Sanomat 13.06.2002
Kirkkomusiikin
ja liedin eminenssi
Kirchenmusik
und Lieder Eminenz / Church music und lieder eminence
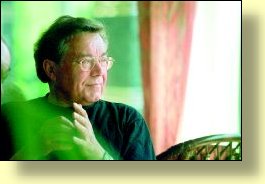
Interview
in finnischer Sprache / in Finnish language
![]()
Münchener
Merkur
12.01.2002
Der
Frauenkirche entgegenfiebern
Peter
Schreier singt in München
Der Wiederaufbau der
Dresdner Frauenkirche zählt zu den erfolgreichsten Bürgerinitiativ-Projekten
der Gegenwart, auch in München engagieren sich die "Freunde
der Dresdner Frauenkirche e.V.". Zugunsten des Wahrzeichens singt
Tenor Peter Schreier, dessen musikalische Karriere sehr eng mit Dresden
verbunden ist, am Montag im Prinzregententheater. Auf dem Programm: Franz
Schuberts "Winterreise". Am Flügel begleitet Helmut Deutsch.
Mit Peter Schreier sprach Dorothea Hußlein.
Welche Erinnerungen
haben Sie an die Frauenkirche vor ihrer Zerstörung?
Schreier: Also, ich war natürlich
noch sehr klein. Wir hatten als Vorbereitung für den Dresdner Kreuzchor
die Gelegenheit, zum Beispiel in der Matthäus-Passion mitzusingen,
und da habe ich eine Aufführung in der Frauenkirche miterlebt. Ich
weiß noch, dass ihre Ausstattung ziemlich überladen war. Die
meisten Erinnerungen drehen sich aber um die Ruine der Frauenkirche, die
für uns nicht wegdenkbar war und ist. Ich gehörte nicht unbedingt
gleich zu den Befürwortern des Wiederaufbaus, weil ich glaubte, dass
ein solches Denkmal noch mehr an die Zerstörung Dresdens erinnern
kann und dass zunächst einmal das Geld in Dinge gesteckt werden müsste,
die in der Stadt wichtiger sind. Aber durch diese Privatinitiative und
das ungeheure Echo, das der Wiederaufbau in der ganzen Welt gefunden hat,
bin ich jetzt sehr glücklich, dass man mitfiebernd der Fertigstellung
entgegensieht.
Geplant ist die Wiedereröffnung 2006, pünktlich zur 800-Jahr-Feier
Dresdens. Planen Sie bis dahin noch weitere Benefiz-Aktivitäten?
Schreier: Eigentlich laufend.
In Dresden wurde für ein weiteres Projekt gesammelt, für die
Synagoge. Ich war dort auch engagiert. Aber die Fördergesellschaft
ist inzwischen aufgelöst worden, weil die Synagoge ja nun steht.
Die Unterstützung lief teilweise parallel zu den Aktionen für
die Frauenkirche. Es wurden also zum Beispiel Konzerte im Frauenkirchen-Keller
veranstaltet, deren Erlös in die Synagoge floss.
In München werden Sie Schuberts "Winterreise" singen.
Gibt es einen speziellen Hintergrund?
Schreier: Nein. Für ein Projekt
wie die Frauenkirche muss man etwas wirklich Reizvolles für die Zuhörer,
speziell für das Liedpublikum wählen. Dazu kommt natürlich
noch die Jahreszeit, die sich sehr für den Zyklus eignet. Und als
Letztes vielleicht auch noch meine besondere Beziehung zu diesem Werk.
Ich habe die "Winterreise" erst ganz spät in Angriff genommen,
also mit meinem 50. Lebensjahr, weil ich einfach glaubte, dass ich die
Reife für die Interpretation noch nicht hatte. Und dass ich das Erleben
einer Situation, wie sie hier geschildert wird, noch nicht nachvollziehen
konnte.
Sie haben die "Winterreise" inzwischen gut 100 Mal gesungen.
Mit wechselnden Klavierbegleitern?
Schreier: Ja, das halte ich für
sehr wichtig. Oder sagen wir: für sehr kreativ, weil man durch jeden
Begleiter neu angeregt wird. Wenn ich ein Programm, gerade diesen "Winterreisen"-Zyklus
singe, dann muss ich von vornherein ausschalten, dass etwas automatisiert
wird. Man kann es auch mit dem bösen Wort "Routine" ausdrücken.
Ich habe Zeit meines Lebens immer vermieden, dass ich auf einen Begleiter
festgelegt war. Das ist ja genauso, wenn ich ständig vor anderem
Publikum, teilweise in anderen Räumen singe.
Was gibt es für Sie immer wieder Neues zu entdecken?
Schreier: Vielleicht nicht
unbedingt Neues zu entdecken, aber etwas aus den Stimmungen heraus zu
entwickeln. Wir Menschen sind alle besonderen Stimmungen unterlegen. Aber
das ist es nicht allein. Ich glaube auch, dass die hektische Zeit heute,
die Zeit, in der man von den Medien geradezu bombardiert wird, dass alle
diese Komponenten eine Spannung im Sänger erzeugen, so dass man seine
Interpretation immer wieder verändert. Und in der Veränderung
überhaupt liegt ja der Reiz der Musik. Der Reiz, eine Momentanstimmung
aufzunehmen und sie auf das Publikum zu übertragen.
Main
Post 05.01.2002
Die
Breitschaft zum Mitdenken und zum Mitfühlen
Ein
Gespräch mit Peter Schreier nach einem Konzert bei der Schubertiade
in Schwarzenberg
Peter Schreier galt
als der "Vorzeige-Sänger" der ehemaligen DDR. Als zehnjähriger
Bub schon hat er als Altus im Dresdner Kreuzchor mitgesungen. Seit Beginn
seiner weltweiten Karriere gilt er als einer der hervorragendsten Liedsänger.
Von 1967 an hat er für 25 Jahre bei den Salzburger Festspielen mitgewirkt,
doch seit Juni 2000 hat er sich nach 41 Jahren als Opernsänger völlig
zurückgezogen. Jedoch wirkt er nach wie vor als Dirigent und lyrischer
Tenor. Nach einem gefeierten Liederabend bei der Schubertiade hat sich
der immer noch vielbeschäftigte Sänger die Zeit genommen einige
Fragen in der stimmigen Atmosphäre eines gemütlichen, österreichischen
Romantikhotels für unsere Leser zu beantworten.
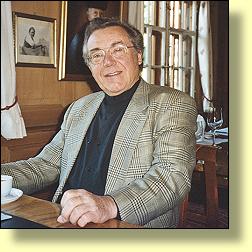
Wie würden
Sie entscheiden: Bach oder lieber Mozart?
Peter Schreier: Diese Frage ist natürlich gleich eine ganz
große Herausforderung für mich; denn ich kann diese zwei Komponisten
nicht trennen. Sie hängen beide ganz eng mit meiner Laufbahn zusammen.
Bach geht natürlich noch weiter zurück in meine Knabenchorzeit,
er hat mich geprägt, - und Mozart hat mir meine ganze Opernlaufbahn
vorgezeichnet. Also, ich würde da keine Klassifizierung vornehmen
können. Beide gehören zu meinen Favoriten. Doch da kommen vielleicht
auch noch Schubert und Schumann dazu. Aber irgendwie sind Bach und Mozart
schon zwei Welten und man kann sie natürlich unterscheiden, alleine
vom Hörerlebnis. Aber nur Bach ist, wenn man so will, die Grundlage
für alle großen nachfolgenden Komponisten. Und keiner schämt
sich dessen, sondern beruft sich auf Johann Sebastian Bach.
Mozart, was ist
das Besondere für Sie bei seiner Musik?
Peter Schreier: Wenn ich das in einem Satz sagen darf, dann würde
ich sagen: dass er auch im Schmerz noch heiter sein kann.
Wie vertragen sich damit Wagner-Rollen? Ist das nicht total gegensätzliche
Musik?
Peter Schreier: Wagner müssen Sie in meinem Falle von
einer anderen Warte sehen. Ich bin ja mit den Evangelistenpartien in Bachs
Passionen groß geworden und alleine Herbert von Karajan hat mich
nach einer Matthäus Passionsaufnahme dazu herausgefordert. Er sagte:
"Wenn ich Ihren Evangelisten höre, könnte ich mir vorstellen,
dass Sie einen ganz fantastischen Loge singen!" Und bis dahin hatte
ich vom Ring überhaupt keine Ahnung.
Doch eigentlich muss man gar nicht mal so sehr differenzieren. Was ist
das Singen denn wirklich? Es ist der Zwang zur deutlichen Diktion und
der Mut seine Stimme auch mal zu verändern, und nicht immer nur "schönen"
Klang zu bieten, sondern eben eine Partie zu charakterisieren. Und das
macht sich natürlich gerade bei so einer Partie wie dem Loge oder
dem David in den Meistersingern sehr gut. Und es ist ja auch von Wagner
so komponiert, dass man durchaus nicht überfordert wird als lyrischer
Tenor. Das ist keine schwere Heldenpartie. Ich meine, früher wurde
das zwar von den Heldentenören gesungen, aber das war dann auch dementsprechend.
Es wurde eben nur losgesungen. Da war keine Farbe. Gerhard Stolze hat
eigentlich als erster so was als Charaktertenor gesungen, und das ist
bis heute so geblieben, und das mit Recht.
Die Expressivität,
die Ihre Musik auszeichnet. Ist sie an erlernt oder von innen spontan
empfunden?
Peter Schreier: Zunächst mal: wenn Expressivität
an erlernt wäre, dann würde ja jeder Abend genauso sein. Und
das ist er nicht. Sie werden bei mir nicht erleben, dass, - weder bei
einem Liederabend, noch bei der Partie eines Evangelisten, jemals eine
Interpretation gleich ist. Sie ist immer anderes. Und sie wird eigentlich
auch immer aus dem Augenblick heraus gestaltet. Es gibt ja so viele Komponenten,
die dazu führen, dass man bei all den vielen Aufführungen, die
man gesungen hat, angeregt wird. Man denke nur an den Raum, oder an die
Mitmusizierenden, den Dirigenten, oder, auch an das Publikum, das einen
schon beeinflusst. Wenn man das Gefühl hat ein sehr konzentriertes
Publikum vor sich zu haben, dann hat das sofort Auswirkungen auf den Künstler
auf der Bühne. Also jedenfalls ist das so bei mir!
Musik als Klangrede
ist Sprache in Tönen, das heißt Ausdeutung der Kompositionen
nach deren inhaltlicher Aussage.
Peter Schreier: Was heißt denn Klangrede eigentlich? Für
mich heißt das dynamisches, plastisches Musizieren. Ich meine Rede
ist ja immer Sprache, und, wenn in der Musik keine Sprache da ist, kann
man eigentlich auch nicht von Rede sprechen. Ich glaube, der Ausdruck
ist einfach nicht richtig gewählt. Denn man will ja etwas bewirken,
was in Wirklichkeit eigentlich gar nicht machbar ist. Ich weiß schon,
was Harnoncourt damit meint, mit der Klangrede. Nämlich, dass man
wirklich spürt, welche Stimmungen, welche Situationen in dieser Musik
gerade zu hören sind, und nicht, dass die Musik, wie so ein Perpetuum
Mobile ohne Nuancen und ohne individuelle Interpretation abläuft.
Wie kommen nun
Sie zu so einer stimmigen Interpretation?
Peter Schreier: Das ist natürlich die jahrelange Beschäftigung
mit dieser Literatur, und auch das, was man im Laufe seines Lebens gelesen
hat, was man auch von anderen Musizierenden als Anregung bekommen hat.
Man kann eigentlich ganz allgemein sagen, dass es das Ergebnis davon ist,
sich intensiv und lange mit einem Werk beschäftigt zu haben.
Wodurch werden Ihre persönlichen Interpretationen lebendig und
spannend, sodass Gesang an sich etwas ausdrückt?
Peter Schreier: Ich glaube, das ist überhaupt einer der
ganz entscheidenden Punkte, auf den es in der Musik, speziell im Gesang
ankommt. Es hat keinen Sinn schöne Töne zu zeigen, oder schöne
Stimmen, oder gar große Stimme. Für mich ist das Kriterium
einzig und alleine die Aussage, die hinter der Person des Künstlers,
des Interpreten steht. Und die verlangt einfach, dass man das Publikum
anspricht und es einbezieht, in das, was man denkt und singt.
Und es geht mir nach wie vor auf die Nerven, wenn ich im Radio Aufnahmen
höre, in denen ein Sänger nur schön und glatt singt, und
ich keinerlei Eindruck von dem habe, was er singt. Aber es gehört
sicherlich zu einer ausdrucksstarken Interpretation ein gewisser Mut;
denn man geht ungern von der Stimme weg, und will ungern den Wohlklang
der Stimme vermindern oder aufgeben. Doch es muss ja nicht gleich hässlich
klingen, aber es muss irgendwo eine Farbe haben, die den Hörer interessiert.
Demzufolge erübrigt
sich fast die Frage nach dem "Wichtigsten" in der Musik? Ist
es der musikalische Ausdruck oder technische Virtuosität?
Peter Schreier: Die technische Virtuosität ist eigentlich
die Voraussetzung für die musikalische Gestaltung. Und es ist ja
nicht nur die musikalische Gestaltung! Im Prinzip ist es, wenn man vom
Sänger ausgeht, ja auch die sprachliche Gestaltung, das Einbeziehen
der Möglichkeiten, die uns die Sprache gibt durch das Herausstellen
eines bestimmten Wortes, oder durch die Einfärbung eines bestimmten
Wortes. Ich bin sowieso ein Fanatiker der Sprache und habe was dagegen,
wenn man Lieder hört und dabei nur wenig verstehen kann.
Was ist für
Sie das ausdrucksstärkste, intimste, innigste, feinste Ausdrucksmedium
des Gesangs? Oper, Oratorium, Messe oder Lied?
Peter Schreier: Das ist ganz klar! Dort, wo man am meisten Ausdruck
und Verinnerlichung findet, - das ist das Lied, einwandfrei! Aber es verlangt
natürlich vom Hörer eine große Bereitschaft mitzudenken
und mitzufühlen. Ich meine bei einer Oper, einem Orchesterkonzert
oder einem Oratorium, dort ist erst mal das "Spektakel" als
große "Show" für den Zuhörer einfacher zu begreifen,
weil auch das Auge dort was geboten bekommt. Das Lied dagegen ist eine
viel subtilere Sache! Hier ist es eben auch eine Frage der Bereitschaft
auf der Seite des Sängers das Innerste zu geben und auf der Seite
des Hörers sich da hineinzuhören. Aber ich habe immer, besonders
in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass es dafür immer
ein Publikum gibt. Und das ist dann immer auch ein ganz besonderes.
Was fasziniert
Sie am Dirigieren?
Peter Schreier: Eigentlich fasziniert mich überhaupt nichts
am Dirigieren. Es geht mir nur darum, wie ich meine Vorstellungen selbst
umsetzen kann.
Das betrifft zuerst die Bach'schen Werke, die ich ja seit Jahrzehnten
singe. Natürlich habe ich da nach so langer Zeit eine ganz bestimmte
Interpretationsvorstellung. Und diese kann man eben nur durchsetzen, wenn
man selbst dirigiert. Wollte man es negativ ausdrücken, könnte
man sagen, dass das Dirigieren vielleicht etwas ganz Egoistisches ist.
Sie sagten, dass
Sie nur noch beschränkte Zeit singen wollen. Was planen sie danach
? Werden Sie dennoch dann weiter dirigieren?
Peter Schreier: Na ja, was heißt singen wollen? Ich bin
66 Jahre und da ist das einfach so. Das kann ich gar nicht beeinflussen.
Es geht vielleicht noch zwei, drei Jahre, aber ich stecke mir da kein
Ziel. In der Oper, da habe ich ja schon voriges Jahr aufgehört. Vielleicht
werde ich auch danach noch dirigieren, aber ich will mich da nicht festlegen,
denn eigentlich will ich auch einfach nur mal leben. Ich stehe seit meinem
10. Lebensjahr, - ich will nicht gerade sagen unter diesem Stress, aber
da hat man doch auch mal das Recht loszulassen. Und im übrigen ist
es ja auch so, dass man nichts Halbes machen kann. Man kann nicht sagen,
jetzt mach ich nur noch die Hälfte und nehme das alles mal ein bisschen
locker. Das geht nicht. In einem künstlerischen Beruf muss man immer
voll da sein. Da gibt es nun mal keine halben Sachen. Halbtagsarbeit,
oder so was, ist da nicht drin.
Meisterkurse und
Unterricht. Werden Sie vielleicht nun verstärkt zum Pädagogen,
zum Didaktiker, um eigene Erfahrungen weiterzugeben?
Peter Schreier: Das ist nun eine Frage, die für mich fast
peinlich ist; denn ich habe dafür, glaube ich nicht genügend
Geduld. Und andererseits habe ich auch Vorbehalte, wenn ich unterrichte;
denn ich weiß ja noch längst nicht, ob ich meinen Schülern
das Singen beibringen kann. Das hängt doch auch sehr stark von den
Schülern ab! Ob sie das begreifen, was ich sage. Denn es gibt ja
viele Wege, die nach Rom führen und die letztendlich Erfolg bringen
können. Und, weil ich das nicht garantieren kann, möchte ich
diese Verantwortung auch nicht übernehmen. Ich gebe hin und wieder
mal Interpretationskurse, das eine Sache, da kann ich mich artikulieren
und habe auch das Gefühl, dass man da was zu sagen hat, und das wird
ja auch gut abgenommen. Aber auch dort gibt es schon wieder Probleme,
wenn ich im Kurs Leute dabei habe, die technisch noch nicht fertig sind.
Dann hat das alles nicht viel Sinn; denn dann können sie das nicht
umsetzten, was ich zeige und von ihnen erwarte.
Welch Musik hören
Sie privat gerne?
Peter Schreier: Jazz!! Oscar Peterson, das ist mein Favorit.
Was genießen
Sie besonders im Privaten, vielleicht ein schönes Essen?
Peter Schreier: Das nicht so besonders, da muss ich leider immer sehr
aufpassen, dass nicht zuviel ansetzt, aber privat genieße ich meine
Hang zur Natur. Wäre ich nicht Sänger geworden, wäre ich liebend
gerne Bauer geworden.
Weltweit haben
sie unglaublich viele Fans. Da gibt es sicher angenehmere und auch eher
aufdringliche. Wie wird man mit dieser zweiten, eher unangenehmen Fangruppe
fertig?
Peter Schreier: Oh ja, sehr wohl ! Solche Fans haben ja auch
keine Einsicht, wenn man zu ihnen mal deutliche Worte spricht. Die werden
dann wahrscheinlich, - ich nehm's an, doch sehr, sehr verärgert reagieren.
Deswegen muss man einfach diplomatisch sein und aufdringliche Fans halt
hinnehmen. Aber es sind nur ganz wenige, die versuchen einem zu nahe zu
kommen.
Sogar in Japan
gibt es begeisterte Anhänger von Ihnen. Existiert dort immer noch
der Japanische Schreier-Fanclub?
Peter Schreier: Ja, ja, das sind ganz liebe Leute! Immer, wenn
ich in Japan bin, machen wir dann dort mit denen ein Treffen. Da werden
dann Bilder und Daten ausgetauscht und alle möchten wissen, was ich
mache und wo ich mich aufhalte.
Was sind oder waren
für Sie die Gipfel der künstlerischen Anerkennung?
Peter Schreier: Das waren mehrere. Doch vielleicht war eine der schönsten
Ehrungen, die ich bekommen habe, die Ehrenmitgliedschaft im Musikverein in
Wien, wo auch Beethoven und Schubert Ehrenmitglieder sind. Das hat mich wirklich
sehr angerührt.
Gabi Zahn am 3. September 2001.